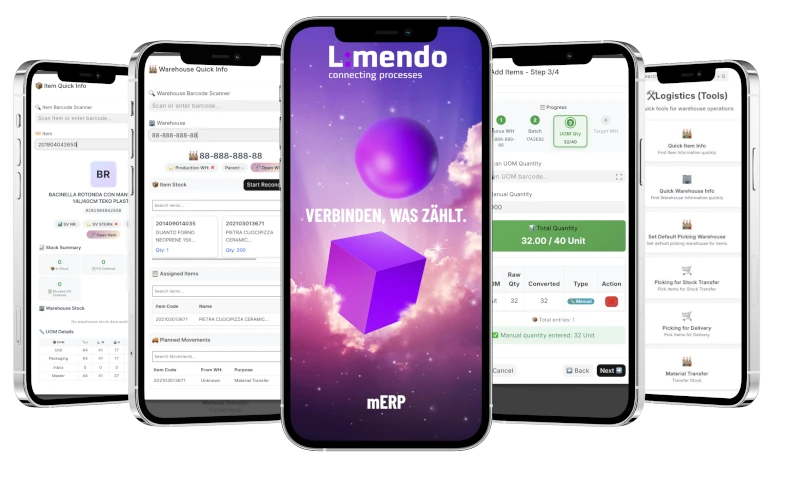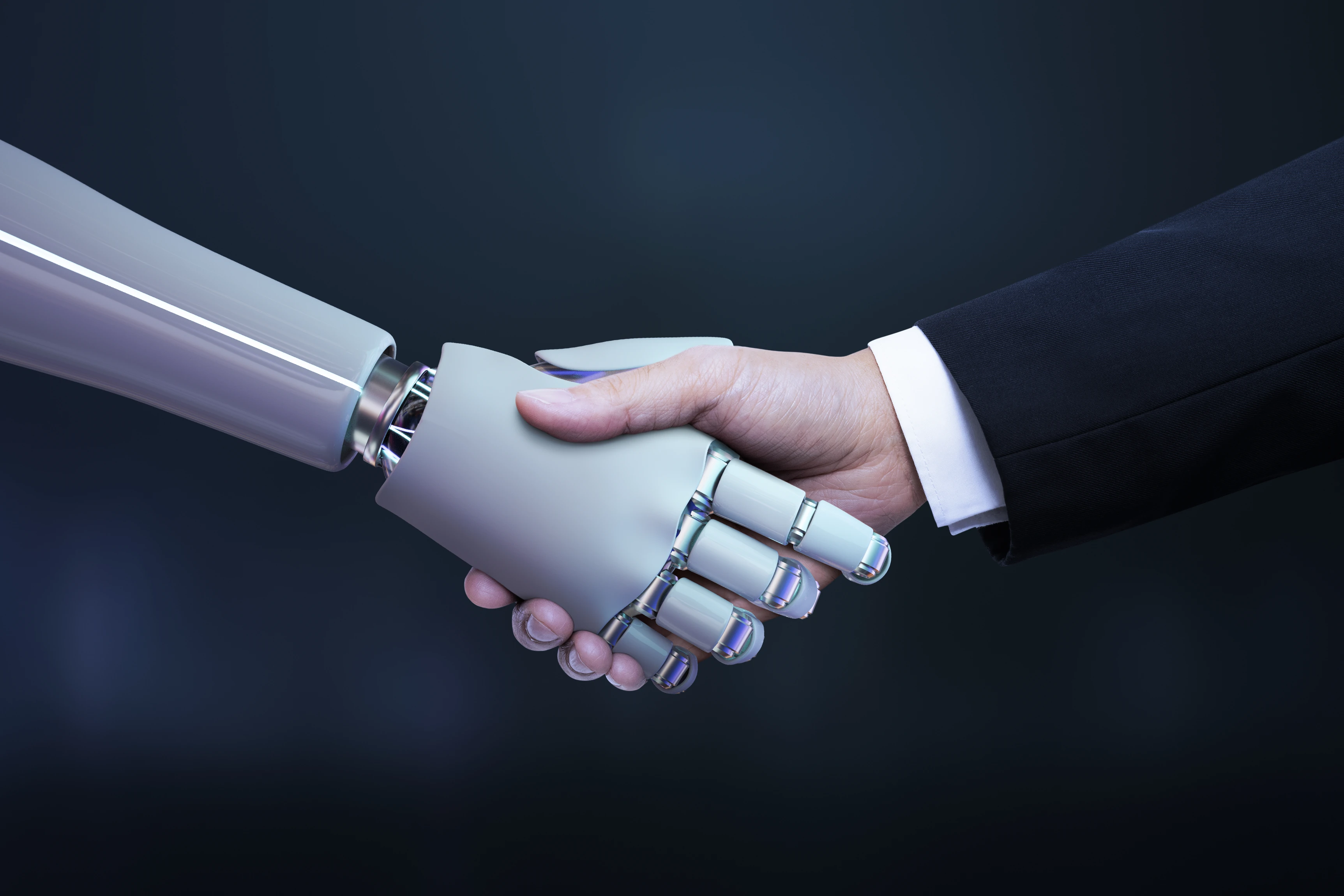Erinnerung vs. Träume
von
Hannes Lösch
12.11.2025

Am 11.11.2025 lud die Raiffeisenkasse Lana zum Vortrag mit Zukunftsforscher Dr. David Bossard. Wir haben interessiert zugehört und aus diesem besonderen Vortrag, der viel Raum zum Denken gab, unsere Sclüsse gezogen.
Der Vortrag von David Bossard, einem Zukunftsforscher mit Gespür für gesellschaftliche Spannungen und technologische Brüche, war keine trockene Prognose über die nächsten Jahre – er war eine Einladung, die Gegenwart mit anderen Augen zu betrachten. Bossard sprach über die tektonischen Bewegungen unserer Zeit: über Macht, Bevölkerung, künstliche Intelligenz, über Europas Identität und die Frage, was vom Menschen bleibt, wenn Technik zu einer zweiten Natur wird.Sein Vortrag gliederte sich dabei nicht in Themenblöcke, sondern in gedankliche Wellen. Jede Welle baute auf der vorhergehenden auf – eine Bewegung zwischen Sorge und Zuversicht.
1. Europa, China und die USA – drei Zivilisationen auf unterschiedlichen Pfaden
Bossard begann mit einem Blick auf die globale Landkarte. Drei Machtblöcke prägen die Welt, sagte er: Europa, die USA und China. Doch ihre Rollen und Dynamiken könnten kaum unterschiedlicher sein.
Europa, so seine Diagnose, steht heute da wie eine alternde Zivilisation – stolz, reich, gebildet, aber träge. In den entscheidenden Kräften der Gegenwart, den sogenannten „Hard Powers“ wie Technologie, Industrie oder militärische Stärke, ebenso wie in den „Soft Powers“ wie digitaler Innovationskraft, kultureller Anziehung oder unternehmerischer Risikofreude, sei Europa schlecht aufgestellt. Wir verwalten, was wir aufgebaut haben, statt Neues zu schaffen.
Diese Schwäche ist keine Frage mangelnden Talents, sondern der Mentalität. Europa ist ein Kontinent der Erinnerung geworden, weniger der Vision. Während die USA immer wieder aus Krisen Innovationsenergie schöpfen und China auf planwirtschaftliche Geschlossenheit setzt, sucht Europa nach Orientierung – zwischen Datenschutz und Abhängigkeit, zwischen Wohlstand und Zukunftsangst.
Bossard formulierte es sinngemäß so: Europa lebt am schönsten – aber es gestaltet am wenigsten. Die Lebensqualität sei unbestritten, der soziale Zusammenhalt hoch, doch die großen technologischen Entwicklungen finden andernorts statt.
In den USA sieht Bossard die Kraft des Kapitals am Werk. Wenige Bundesstaaten – New York, Kalifornien, Texas – tragen einen Großteil der Wirtschaftsleistung. Das Land bleibt ein Magnet für Ideen und Investitionen, doch sein Modell basiert nach wie vor auf einem fossilen, finanzgetriebenen System. Die Ungleichheiten wachsen, die Industrie konzentriert sich, und das „amerikanische Traumversprechen“ verblasst.
China wiederum ist für Bossard der „kontrollierte Gegenentwurf“: zentralistisch, planend, strategisch. Das Land kombiniert Effizienz mit Disziplin, Technologie mit Überwachung. In Chinas Wirtschaftslogik zählt nicht der einzelne Mensch, sondern die Bewegung der Masse. Während Europa in Werten denkt und Amerika in Märkten, denkt China in Macht. Das macht es zum natürlichen Gegenspieler des Westens – nicht aus Feindseligkeit, sondern aus Systemlogik.
2. Demografie und Wohlstand – die Grenzen des Wachstums
Von der Weltpolitik führte Bossard elegant zur Demografie – dem stillen Motor jeder wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Die Wachstumslogik des 20. Jahrhunderts beruhte auf einem einfachen Prinzip: Mehr Menschen bedeuten mehr Arbeit, mehr Konsum, mehr Wohlstand. Doch dieses Prinzip verliert seine Grundlage.
Die Erwerbsbevölkerung in den meisten Industrieländern schrumpft. Europa und Japan altern, China folgt, und auch die USA kämpfen mit struktureller Arbeitsknappheit. Bossard zeigte, wie sich der Altersaufbau verschiebt: weniger Kinder, mehr Rentner, eine Mitte, die wirtschaftlich und sozial überfordert ist.
Das wirft die zentrale Frage auf: Wie kann Wohlstand entstehen, wenn die Bevölkerung stagniert oder abnimmt?
Bossard argumentierte, dass Wachstum künftig nicht mehr aus Quantität, sondern aus Qualität kommen müsse – aus Bildung, Produktivität, Technologie und Effizienz. Staaten und Unternehmen, die lernen, mit weniger Menschen mehr zu schaffen, werden überleben. Nicht, weil sie schneller oder größer sind, sondern weil sie intelligenter mit Ressourcen umgehen.
Das klassische Verständnis von Wirtschaft als ständiger Expansion müsse neu gedacht werden. „Wohlstand“, so Bossard, „kann auch Stabilität heißen.“ Es gehe nicht mehr darum, immer mehr zu produzieren, sondern darum, besser zu leben, statt mehr zu haben.
3. Die Künstliche Intelligenz – Fortschritt und Furcht
Das Thema Künstliche Intelligenz war der emotionale Kern seines Vortrags. Bossard beschrieb sie nicht als Bedrohung, sondern als Zäsur – eine neue Phase menschlicher Evolution, vergleichbar mit der industriellen Revolution oder der Erfindung der Eisenbahn.
Er zog einen faszinierenden Vergleich: Als im 19. Jahrhundert die Eisenbahnnetze entstanden, veränderte das die Wahrnehmung von Raum und Zeit radikal. Güter, Menschen, Ideen konnten plötzlich in ungeahntem Tempo transportiert werden. Doch mit der neuen Freiheit kam eine neue Unsicherheit. Menschen misstrauten der Geschwindigkeit, sie fürchteten Kontrollverlust, Entfremdung, Entwurzelung.
Genau das gleiche Muster, so Bossard, wiederholt sich heute mit der KI. Sie verknüpft Daten über Kontinente hinweg, beschleunigt Entscheidungen, verschiebt Grenzen menschlicher Zuständigkeit. Wieder entsteht Fortschritt – und wieder wächst die Angst.
Doch Bossard beruhigte: Die Vorstellung einer Superintelligenz, die den Menschen überflügelt, sei noch weit entfernt. Künstliche Intelligenz sei mächtig in der Datenverarbeitung, aber sie habe kein Bewusstsein, keine Intuition, keine Werte. Sie könne rechnen, aber nicht fühlen; ableiten, aber nicht verstehen.
Die größere Gefahr liege nicht in der KI selbst, sondern darin, wie wir auf sie reagieren. Ob wir sie als Werkzeug oder als Gegner betrachten, als Chance oder als Bedrohung, entscheidet über ihre Wirkung. Bossard forderte, KI als Spiegel unserer eigenen Gesellschaft zu begreifen – sie zeigt uns, wie wenig wir über unsere eigenen Systeme wissen.
In dieser Phase der Unsicherheit sieht er die Parallele zur Eisenbahnzeit: Auch damals führte die technologische Beschleunigung zu sozialen Spannungen. Aber am Ende wurde sie zur Grundlage moderner Zivilisation.
4. Mensch – Natur – Technik: Wege aus der Unsicherheit
Im letzten Teil seines Vortrags suchte Bossard nach Antworten auf die Frage: Wie begegnen wir einer Zukunft, die immer komplexer, schneller, unvorhersehbarer wird?
Er projizierte eine Folie, die wie eine mentale Landkarte wirkte – mit Begriffen, die mehr Haltung als Methode waren:
– Nachhaltigkeit ist wichtig, aber zu defensiv. Sie schützt, ohne zu inspirieren. Sie bleibt ein moralisches „Nicht-schaden“, statt ein kreatives „Besser-machen“.
– Robustheit bedeutet, Störungen zu ertragen, statt an ihnen zu scheitern. Eine robuste Organisation oder Gesellschaft ist widerstandsfähig, aber nicht starr.
– Antifragilität, ein Begriff des Philosophen Nassim Taleb, geht einen Schritt weiter: Sie gedeiht durch Stress, sie wächst an Unsicherheit. Systeme, die antifragil sind, verwandeln Krisen in Chancen.
– Darwinismus ist hier kein Zynismus, sondern eine Erinnerung an die Natur: Anpassung ist die ultimative Überlebensstrategie.
– Mindset steht für die innere Haltung gegenüber Wandel. Wer Veränderung als Bedrohung sieht, wird sie bekämpfen; wer sie als Lernprozess begreift, wird stärker aus ihr hervorgehen.
– Bewusster Konsum schließlich bedeutet, Genuss mit Verantwortung zu verbinden – nicht asketisch, sondern intelligent.
Diese Begriffe formten den roten Faden seines Appells: Zukunftsfähigkeit ist kein Zustand, sondern eine Fähigkeit zur Bewegung. Gesellschaften, Unternehmen, Individuen – sie alle müssen lernen, Unsicherheit zu tolerieren und Wandel aktiv zu gestalten.
Bossard machte deutlich, dass technologische Lösungen nur so gut sind wie das menschliche System, das sie nutzt. Ein intelligentes Werkzeug in den Händen eines ängstlichen Geistes führt nicht zu Fortschritt. Darum müsse Bildung wieder zur Priorität werden – nicht nur im technischen, sondern im ethischen Sinn.
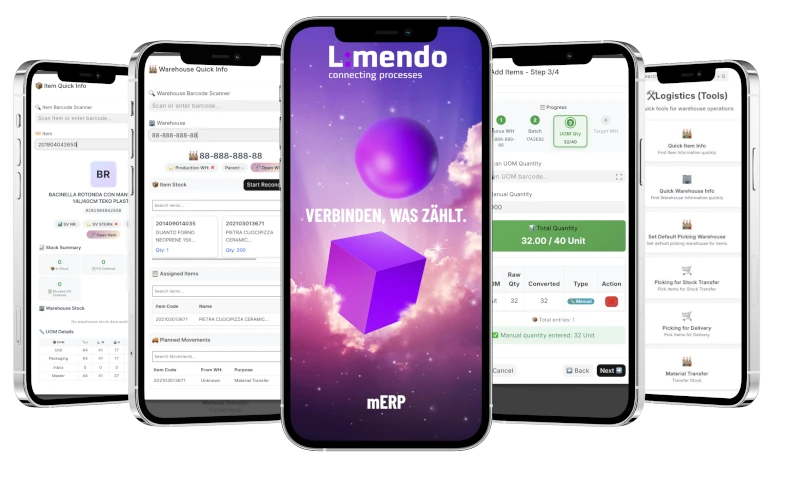
5. Erinnerungen und Träume
Zum Schluss kam Bossard auf ein Thema, das fast poetisch klang – und doch tief politisch war: das Verhältnis von Erinnerungen und Träumen.
Er zeigte eine Folie mit dem Satz: „Wenn Erinnerungen die Träume übersteigen, ist das Ende nahe.“ Ein Zitat von Thomas Friedman, das Bossard auf die europäische Gesellschaft bezog.
Europa, sagte er, blickt zu sehr zurück. Wir pflegen unsere Vergangenheit, unsere Kultur, unsere Traditionen – doch wir haben verlernt, in Möglichkeiten zu denken. Unsere Städte sind Museen des Fortschritts von gestern.
Bossard sprach von einer „Welt der Erinnerungen“, in der Wiederholungen, Rituale und Verlangsamungen überhandnehmen. Wenn eine Gesellschaft sich zu sehr in Nostalgie verliert, verliert sie ihren Zukunftshunger.
Er plädierte dafür, wieder zu träumen – nicht in utopischem Überschwang, sondern im Sinne des Mutes, Neues zu wagen. Innovation beginnt dort, wo Erinnerung nicht mehr genügt.
6. Ein neuer Realismus
Am Ende seines Vortrags stand kein dystopisches Bild, sondern ein neuer Realismus. Bossard zeigte, dass Unsicherheit kein Feind ist, sondern eine Bedingung für Wachstum. Die Welt wird komplexer, ja – aber sie wird auch intelligenter, vernetzter, vielfältiger.
Europa müsse lernen, nicht nur zu bewahren, sondern zu riskieren. Nicht nur zu analysieren, sondern zu handeln. In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz zur Infrastruktur des Denkens wird, bleibe der menschliche Faktor entscheidend: Haltung, Neugier, Verantwortung.
Bossards Worte hallten nach – weil sie nicht Angst machten, sondern forderten. Sein Appell war einfach, aber tief: Zukunft entsteht nicht durch Technik, sondern durch Menschen, die sie richtig einsetzen.
Fazit
David Bossards Vortrag war weniger ein Blick in die Zukunft als ein Spiegel unserer Gegenwart. Zwischen künstlicher Intelligenz und kollektiver Unsicherheit, zwischen Wohlstandsangst und Wachstumsgrenzen, forderte er einen geistigen Wandel: von der Angst zur Anpassung, vom Erinnern zum Träumen, vom Überleben zum Gestalten.
Nur wer lernt, unter Druck zu wachsen – antifragil, bewusst, neugierig – wird in dieser neuen Welt bestehen. Europa, so seine Hoffnung, kann das. Wenn es wieder wagt, zu träumen.